Ab dem Jahr 2024 müssen Etagenheizungen so betrieben werden, dass mindestens 65 % des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Diese Regelung zieht eine Austauschpflicht für ältere Heizsysteme nach sich, bedeutet jedoch nicht, dass sofortige Maßnahmen erforderlich sind. Im folgenden Artikel werden die neuen Vorschriften erläutert, Fristen aufgezeigt und kosteneffiziente Alternativen vorgestellt.
Neue Regelung: Ab 2024 müssen Etagenheizungen mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Dies betrifft insbesondere ältere Gasetagenheizungen.
Kosten: Die Austauschkosten variieren zwischen 3.500 und 7.000 Euro. Staatliche Förderprogramme können bis zu 70 % der Kosten abdecken.
Nachhaltige Alternativen: Heizsysteme wie Wärmepumpen und Hybridheizungen bieten umweltfreundlichere und langfristig günstigere Lösungen für die Beheizung von Mehrfamilienhäusern.

Ab dem Jahr 2024 müssen in Gebäuden mindestens 65 % des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Diese Regelung zielt darauf ab, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die kommunale Wärmeplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für die Umsetzung dieser Vorgaben bildet.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Eigentümerinnen und Eigentümer funktionierende Gasetagenheizungen nicht sofort austauschen müssen. Die Austauschpflicht für Gasetagenheizungen greift erst zu einem späteren Zeitpunkt, abhängig von der kommunalen Wärmeplanung. Dies gibt Ihnen ausreichend Zeit, sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt vor, dass neue Gasetagenheizungen die Nutzung von erneuerbaren Energien sicherstellen müssen. Heizsysteme, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden und älter als 30 Jahre sind, müssen ersetzt werden. Neue Heizsysteme sollten mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Diese Vorgaben gelten sowohl für einzelne Gasetagenheizungen als auch für zentrale Heizsysteme.
Der Anteil erneuerbarer Energien muss bei neuen Heizungen gemäß dem GEG mindestens 65 % betragen. Diese Regelung wird insbesondere für Bestandsanlagen relevant, wenn eine Heizung ersetzt werden muss und eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Staatliche Zuschüsse können dabei helfen, die Kosten für den Austausch zu senken. Die Förderung kann zwischen 30 und 70 % der Kosten betragen.
Einzelne Gasetagenheizungen erhalten in der Regel keine Fördermittel, da deren kleinteiliges Heizkonzept nicht ausreichend mit erneuerbaren Energien kompatibel ist. Daher ist es umso wichtiger, alternative Heizlösungen in Betracht zu ziehen, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und langfristig kosteneffizienter sind.
Die Übergangsfrist für bestehende Gasetagenheizungen beträgt 5 Jahre nach dem Austausch der ersten Heizungsanlage. Wenn Sie innerhalb dieser Frist keine Entscheidung treffen, sind Sie verpflichtet, auf eine zentrale Heizungsanlage umzurüsten. Diese Frist gibt Ihnen ausreichend Zeit, die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Bis Ende 2024 müssen Wohnungseigentümergemeinschaften alle relevanten Informationen zu ihren Gasetagenheizungen zusammentragen. Der Verwalter ist verpflichtet, diese Informationen von den Eigentümerinnen und Eigentümern anzufordern und innerhalb der festgelegten Frist vorzulegen. Dies stellt sicher, dass alle Beteiligten über die notwendigen Informationen verfügen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Gesamtkosten für den Austausch einer Etagenheizung belaufen sich auf etwa 3.500 bis 7.000 Euro pro Wohnung. Diese Kosten variieren je nach Art der neuen Heizungsanlage und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Die Anschaffungskosten für Gasetagenheizungen fallen häufig geringer aus, da keine zusätzlichen Warmwasserspeicher benötigt werden.
Bei der Planung eines Heizungstauschs sollten auch die Installationskosten berücksichtigt werden, die insbesondere in älteren Gebäuden höher ausfallen können. Zudem sind gegebenenfalls Anpassungen an der Abgasanlage im gesamten Gebäude erforderlich, was zusätzliche Kosten verursachen kann.
Die staatlichen Förderungen für den Heizungstausch können zwischen 30 und 70 % der Kosten betragen. Für Heizsysteme, die erneuerbare Energien nutzen, stehen spezielle Förderprogramme im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur Verfügung. Allerdings erhalten Gasetagenheizungen in den meisten Fällen keine Fördermittel, da sie nicht ausreichend mit erneuerbaren Energien kompatibel sind.
Eine Ausnahme bilden Luft-Luft-Wärmepumpen, deren Installation förderfähig ist. Der Austausch von alten Gasetagenheizungen gegen zentrale Heizsysteme bietet zudem Vorteile wie eine höhere Energieeffizienz und die Möglichkeit, moderne Heizkonzepte zu kombinieren.
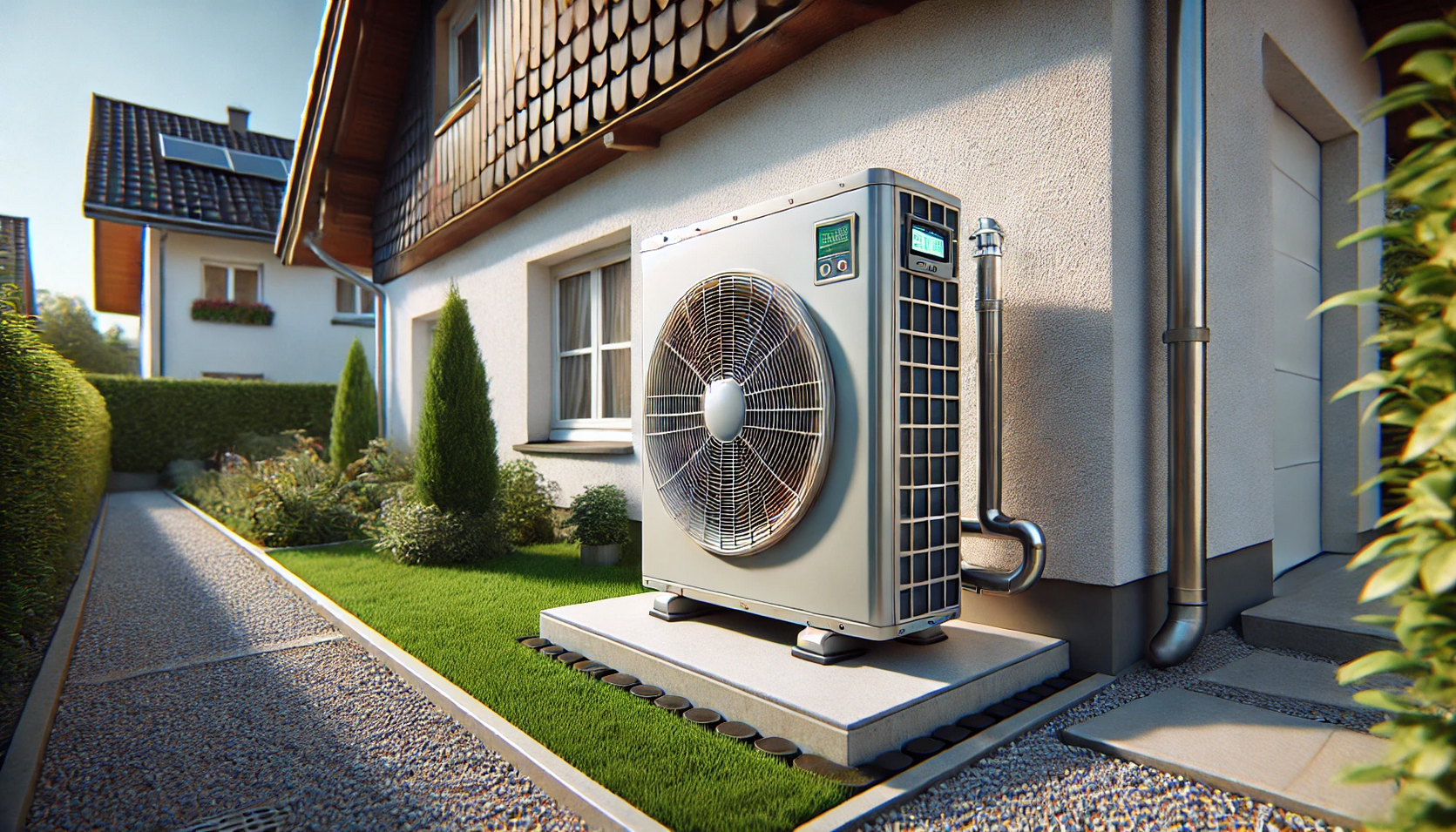
Angesichts der neuen gesetzlichen Vorgaben ist es sinnvoll, Alternativen zur Gasetagenheizung in Betracht zu ziehen. Wärmepumpen, Biomasseheizungen und Hybridheizungen zählen zu den Optionen, die sowohl kostengünstiger als auch nachhaltiger sein können. Diese Systeme ermöglichen es, erneuerbare Energien effizient zu nutzen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.
Gasetagenheizungen haben Nachteile wie einen hohen Platzbedarf, höhere Wartungskosten und Schwierigkeiten bei der Integration erneuerbarer Energien. Beim Austausch stehen sowohl kostengünstige Lösungen als auch nachhaltige Modelle mit höherem technischem Aufwand zur Verfügung.
Wärmepumpen nutzen die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erde), um Gebäude zu heizen oder Warmwasser zu erzeugen. Sie arbeiten nach dem Prinzip der thermodynamischen Umwälzpumpe, indem sie Wärme niedriger Temperatur aus der Umgebung aufnehmen und auf ein höheres Temperaturniveau anheben. Dies macht sie zu einer umweltfreundlichen Heizlösung, die geringere CO₂-Emissionen verursacht als traditionelle Heizsysteme.
Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, darunter Luft-Wasser-, Wasser-Wasser- und Erdwärmepumpen, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile bieten.
Der Einsatz von Wärmepumpen könnte erheblich zur zukünftigen Energienutzung und zur Verringerung des Einsatzes fossiler Brennstoffe in der Heiztechnik beitragen.
Hybridheizungen kombinieren fossile und erneuerbare Energiequellen und müssen die 65-%-Regel einhalten, um als klimafreundliche Lösungen anerkannt zu werden. Diese Systeme bieten die Flexibilität, fossile Brennstoffe zu nutzen, wenn erneuerbare Energien nicht ausreichend verfügbar sind, und können so eine stabile und effiziente Wärmeversorgung gewährleisten.
Fernwärme ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über ein Netzwerk von isolierten Rohren zu den Gebäuden transportiert wird. Ein großer Vorteil von Fernwärme ist die Nutzung von zentral produzierter, umweltfreundlicher Energie, die zu einer Reduktion der CO₂-Emissionen führt. Zudem bietet Fernwärme eine kostengünstige und effiziente Heizlösung, da keine eigenen Heizgeräte installiert werden müssen.
Die Kosten für den Anschluss an das Fernwärmenetz können variieren und sind häufig von individuellen Verbrauchsprognosen abhängig. Es gibt staatliche Förderprogramme, die finanzielle Unterstützung beim Anschluss an das Fernwärmenetz bieten.
Der Austausch von Gasetagenheizungen in Mehrfamilienhäusern erfordert eine gemeinsame Abstimmung, da die Heizungsanlagen oft zum Gemeinschaftseigentum gehören. Fällt eine Gasetagenheizung in einem Mehrfamilienhaus irreparabel aus, haben die Eigentümerinnen und Eigentümer bis zu 5 Jahre Zeit, um zu entscheiden, ob sie die Wärmeversorgung zentralisieren oder dezentral belassen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass ausreichend Zeit bleibt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Wärmepumpen können in Mehrfamilienhäusern effizient eingesetzt werden, da sie die 65-Prozent-Regel automatisch erfüllen und hohe staatliche Förderungen erhalten können. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz stellt eine weitere Möglichkeit dar. Dabei sind jedoch alle Wohnungen an das zentrale System anzuschließen, was die individuellen Betriebskosten für eigene Heizgeräte entfallen lässt. Dennoch fallen für die Fernwärmenutzung eigene Betriebskosten an.
Nach dem Ausfall einer Gasetagenheizung ist die Hausverwaltung verpflichtet, unverzüglich eine Eigentümerversammlung einzuberufen, um über eine klimafreundliche Wärmeversorgung zu beraten. Für den Beschluss zur Installation einer zentralen Heizungsanlage sind zwei Drittel der abgegebenen Stimmen sowie die Zustimmung von mindestens der Hälfte aller Miteigentumsanteile erforderlich. Wird diese Entscheidung getroffen, verlängert sich die Umsetzungsfrist um bis zu 8 Jahre.
Der Bezirksschornsteinfeger kann Informationen zur Art, dem Alter, der Funktionstüchtigkeit und der Nennwärmeleistung der bestehenden Heizanlage liefern. Diese Daten dienen als Grundlage, um die effizienteste Heizlösung für das Gebäude zu ermitteln. Die Hausverwaltung ist verpflichtet, diese Informationen den Eigentümerinnen und Eigentümern bereitzustellen.
Seit dem 1. Januar 2023 können die CO₂-Abgaben zwischen Mieterinnen und Mietern sowie Vermieterinnen und Vermietern aufgeteilt werden. Die Höhe des Anteils richtet sich nach dem Kohlendioxidausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Vermieter tragen dabei einen höheren Anteil, wenn der CO₂-Ausstoß der Heizanlage besonders hoch ist. Diese Regelung soll Anreize schaffen, auf umweltfreundlichere Heizsysteme umzusteigen.

Ab dem 1. Januar 2024 müssen neu installierte Heizsysteme mindestens 65 % ihres Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien decken. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und regelmäßige Wartung, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Systeme sicherzustellen. Die jährlichen Wartungskosten für Etagenheizungen betragen etwa 100 bis 150 Euro pro Gerät.
Der Umstieg auf eine Zentralheizung kann den Verwaltungs- und Betreuungsaufwand für Immobilieneigentümer erheblich verringern. Dies ist insbesondere in Mehrfamilienhäusern von Vorteil, da die Wartungskosten durch die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlagen reduziert werden können.
Die neuen Regelungen zur Austauschpflicht von Etagenheizungen ab 2024 bringen erhebliche Veränderungen mit sich. Sie zielen darauf ab, den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern und den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Für Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer bedeutet dies, dass sie sich auf neue, effizientere Heizsysteme einstellen müssen. Die staatlichen Förderungen können dabei helfen, die Kosten für den Austausch zu senken und den Übergang zu erleichtern.
Die Umstellung auf nachhaltigere Heizlösungen wie Wärmepumpen, Hybridheizungen oder Fernwärme bietet langfristige Vorteile. Diese Systeme sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern können auch die Heizkosten senken und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Es ist wichtig, sich frühzeitig zu informieren und die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Der Weg in eine klimafreundlichere Zukunft beginnt jetzt – packen Sie es an!
Sie müssen Ihre funktionierende Gasetagenheizung nicht sofort austauschen, da die Austauschpflicht erst zu einem späteren Zeitpunkt und abhängig von der kommunalen Wärmeplanung greift.
Für den Austausch einer Etagenheizung sollten Sie mit Gesamtkosten zwischen 3.500 und 7.000 Euro pro Wohnung rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu sichern.
Ja, es gibt staatliche Förderungen für den Heizungsaustausch, die zwischen 30 und 70 % der Kosten betragen können. Es lohnt sich, die aktuellen Programme zu prüfen, um finanziell zu profitieren.
Alternativen zur Gasetagenheizung sind Wärmepumpen, Biomasseheizungen, Hybridheizungen und Fernwärme. Jede dieser Optionen bietet unterschiedliche Vorteile hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
Der Heizungstausch kann die Heizkostenabrechnung positiv beeinflussen, da modernere Heizsysteme in der Regel effizienter sind und den Kohlendioxidausstoß reduzieren, was auch die CO₂-Abgabe betrifft. Dadurch können sowohl Mieter als auch Vermieter von niedrigeren Heizkosten profitieren.